Warum wir langjährige Beziehungen sabotieren, obwohl wir bleiben wollen
- Adela Kohl
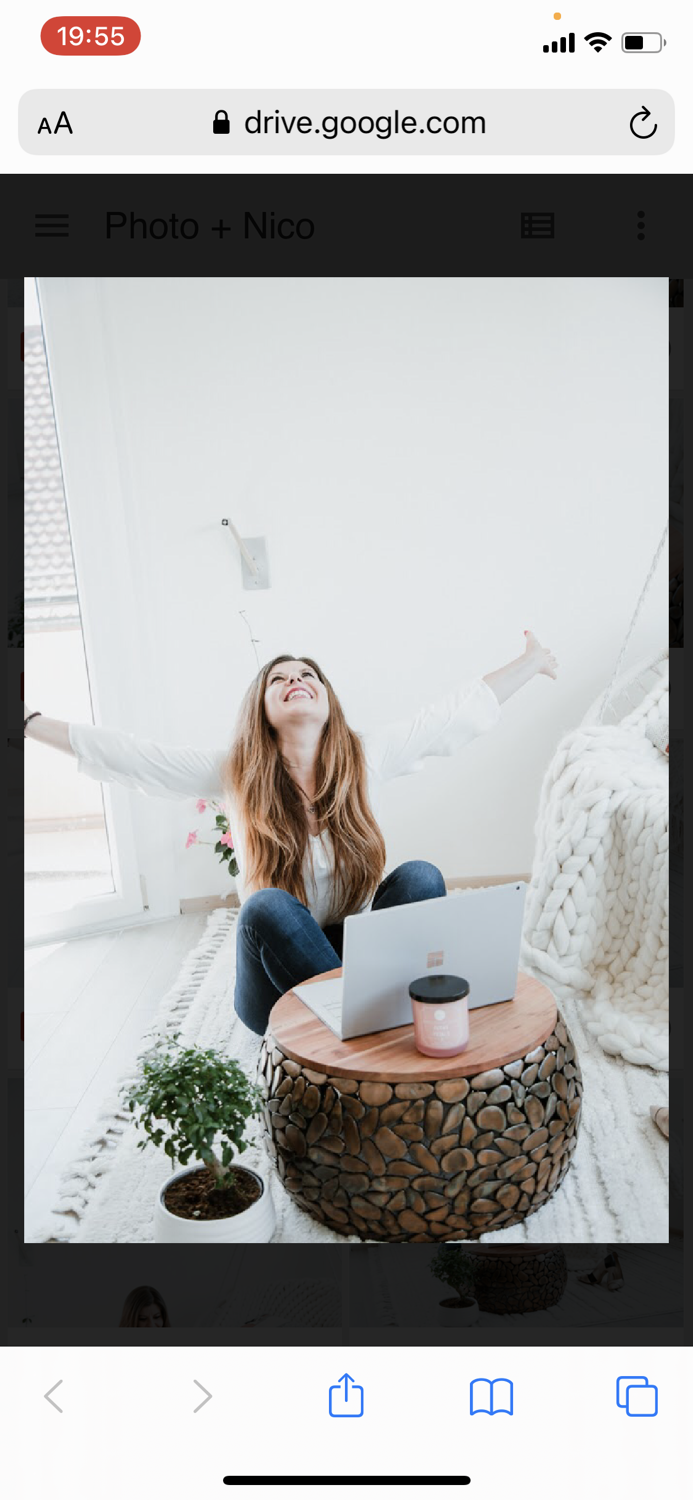
- vor 7 Tagen
- 4 Min. Lesezeit
Über Nähe, Anpassung und das, was in Beziehungen leise verloren geht

In vielen langjährigen Beziehungen gibt es keinen lauten Bruch, keinen großen Streit, kein klares Ereignis, an dem man festmachen könnte, dass etwas verloren gegangen ist. Viel häufiger verändert sich Nähe still, fast unmerklich, so wie Möbel, die schon so lange im Raum stehen, dass man sie nicht mehr bewusst wahrnimmt, obwohl sie immer da sind. Liebe wird dann nicht weniger, sie fühlt sich nur anders an, gedämpfter, sachlicher, funktionaler, und viele nehmen diese Veränderung hin, weil es einfacher ist, als sich einzugestehen, dass etwas im Inneren den Kontakt verloren hat – nicht zum anderen, sondern zu sich selbst.
Nach außen funktioniert der Alltag. Aufgaben sind verteilt, Abläufe eingespielt, Verantwortung wird getragen, man weiß, wer müde ist, wer gerade keine Kapazität hat, wer sich worum kümmert, und genau darin liegt die trügerische Sicherheit. Alles wirkt vernünftig, stabil, erwachsen, fast wie ein gut organisiertes System, in dem jeder seinen Platz kennt. Doch während das Außen reibungslos läuft, beginnt sich innen etwas zu verschieben, langsam, so langsam, dass es lange als Erschöpfung, als Phase, als normale Folge vieler gemeinsamer Jahre gedeutet wird.
Berührung wird nicht abgelehnt, aber sie führt auch nicht mehr richtig ankommen. Der Körper reagiert nicht mit Widerstand, sondern mit einem kurzen Innehalten, einem feinen inneren Prüfen, ob jetzt wirklich Raum dafür ist. Nähe fühlt sich nicht falsch an, aber auch nicht nährend, eher wie etwas, das zusätzlich gehalten werden muss. Viele erklären sich dieses Gefühl damit, dass Nähe eben nicht immer leicht sein kann, dass man nach Jahren nicht ständig offen ist, dass man gemeinsam viel getragen hat, und so wird das Unbehagen nicht hinterfragt, sondern normalisiert.
Oft beginnt dann ein leises Verkürzen, nicht aus Ablehnung, sondern aus einem Bedürfnis nach Luft, nach Raum, nach Momenten, in denen niemand etwas will, nicht einmal Liebe. Berührungen werden kürzer, Gespräche sachlicher, der innere Abstand ein wenig größer, begleitet von Scham, weil Liebe da ist und trotzdem etwas fehlt, das sich schwer benennen lässt. Der Körper fühlt sich dabei häufig angespannt an, immer ein kleines Stück voraus, immer bereit, sich zusammenzunehmen, sich zu regulieren, zu funktionieren.
Nachts zeigt sich das, was tagsüber übergangen wird. Viele wachen immer wieder zur gleichen Zeit auf, liegen wach in einer Stille, die alles verstärkt, den eigenen Atem, die Gedanken, dieses diffuse Gefühl, dass etwas nicht stimmt, ohne dass klar wäre, was genau. Am Morgen geht der Alltag weiter, als wäre nichts gewesen, weil es keine Sprache gibt für das, was nachts spürbar wird.
In solchen Phasen richtet sich der Blick oft nach innen, aber nicht mit Mitgefühl, sondern mit Selbstkritik. Der Gedanke entsteht, dass es an einem selbst liegen muss, am eigenen Anspruch, an einer Unfähigkeit, zufrieden zu sein, an dieser inneren Unruhe, die so vertraut ist, dass sie kaum noch auffällt. Viele versuchen dann, besser zu werden, verständnisvoller, unkomplizierter, erklären viel, halten viel aus, belasten niemanden mit dem, was sie selbst nicht greifen können.
Was dabei übersehen wird, ist ein zentraler Zusammenhang: Nähe verschwindet in solchen Beziehungen nicht, weil Liebe fehlt, sondern weil der Körper irgendwann entscheidet, dass es sicherer ist, nichts mehr zu brauchen, nichts mehr zu erwarten, nichts mehr zu öffnen, was vielleicht wieder zu viel sein könnte.
Dieser Rückzug ist selten bewusst, er ist kein dramatischer Entschluss, sondern ein allmähliches Verstummen, ein Sich-Zusammenziehen, ein Leben auf einer schmaleren inneren Spur, die weniger Schmerz verspricht, aber auch weniger Wärme zulässt.
Hier beginnt das Nervensystem eine Rolle zu spielen, die viele unterschätzen. Ein dysreguliertes Nervensystem fühlt sich nicht an wie Chaos oder Panik, sondern wie ständige innere Wachsamkeit, wie ein Körper, der auch im Schlaf nicht ganz loslässt, der immer bereit ist zu reagieren, zu regulieren, zu halten. In diesem Zustand wird Nähe unbewusst zu einer weiteren Aufgabe, nicht zu einem Ort, an dem man selbst einmal abgelegt werden darf. Beziehung wird dann organisiert, nicht erlebt.
Das Tragische daran ist, dass dies oft als persönliches Versagen interpretiert wird oder als Beziehungsproblem im klassischen Sinn, obwohl es in Wahrheit ein Körper ist, der zu lange stark gewesen ist und irgendwann verlernt hat, wie es sich anfühlt, weich zu werden, ohne Angst davor, was dann passieren könnte. Ein dysreguliertes Nervensystem sabotiert Beziehungen nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Schutz. Es senkt Erwartungen, reduziert Bedürfnisse, zieht sich zurück, um Überforderung zu vermeiden, und genau dadurch geht das verloren, was Nähe eigentlich lebendig macht.
Viele erkennen diesen Zusammenhang erst rückblickend, wenn sie spüren, dass sie sich nicht vom anderen entfernt haben, sondern von sich selbst. Dass sie nicht weniger lieben, sondern weniger fühlen können. Dass das Nebeneinander nicht aus Bequemlichkeit entstanden ist, sondern aus einem inneren Zustand, der keine Kapazität mehr für echte Verbundenheit hatte.
Vielleicht ist das das Menschlichste und zugleich Schmerzhafteste daran: dass Nähe in langjährigen Beziehungen nicht immer verschwindet, weil sie nicht mehr gewollt ist, sondern weil sie nicht mehr gehalten werden kann, wenn das Innere nie wirklich zur Ruhe kommt. Genau deshalb sind Nervensystem und Beziehung so eng miteinander verbunden. Solange der Körper im Dauer-Alarm lebt, wird Beziehung verwaltet statt erlebt, Nähe dosiert statt empfangen und Liebe auf Abstand gehalten, nicht aus Mangel, sondern aus Selbstschutz.
Verstehen wir diesen Zusammenhang, verschiebt sich der Blick. Weg von Schuldzuweisung, weg von der ständigen Frage, wer etwas falsch gemacht hat, weg von dem inneren Druck, eine Beziehung analysieren oder reparieren zu müssen, und hin zu der stilleren, ehrlicheren Frage, was ein Körper eigentlich braucht, um sich wieder sicher genug zu fühlen, um Nähe nicht nur auszuhalten, sondern wirklich zuzulassen. Denn Regulation ist kein Nebenthema und keine Selbstoptimierung, sondern die Grundlage dafür, dass Beziehungen nicht zu Wohngemeinschaften werden, in denen man nebeneinander funktioniert, während man innerlich immer leiser wird.
Und wenn du beim Lesen merkst, dass dein Körper hier leise nickt, dann reicht das erst einmal. Mehr muss gerade nicht entschieden werden. Es gibt Orte, an denen Nervensysteme wieder lernen dürfen, sich zu regulieren – mein Studio ist einer davon.
Adela



Kommentare